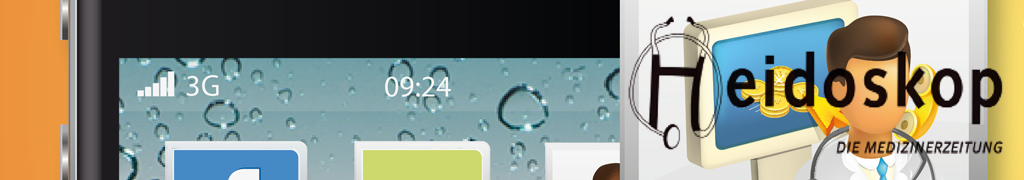"Es gibt in den USA nicht bessere Mediziner,
aber viel mehr gute Vorbilder."
"Heidoskop"-Interview mit Prof. Dr. med. Ronald Cohn
Wie sind
Sie zur Medizin gekommen?
Im Grunde über meinen Großvater.
Er war ein Arzt, den es heute eigentlich
gar nicht mehr gibt. Er praktizierte
mehr oder weniger in seinem
Wohnzimmer. Hin und wieder
nahm er mich in seine Praxis mit.
Das hat mir immer besonders gut
gefallen. Ich habe auch eine seiner
Eigenschaften übernommen: Da er
sich keine Namen merken konnte,
waren bei ihm immer alle "Schätzchen"
und "Süße". Als kleiner Junge
hat mich das unwahrscheinlich
angesprochen, weil ich das sehr liebenswürdig
fand (lacht).
Mit ungefähr 16 wollte ich mich
versichern, dass der Arztberuf der
richtig für mich ist. Ob sie das jetzt
drucken wollen oder nicht überlasse
ich Ihnen, aber ich war ein
sehr schlechter Schüler im Gymnasium
und anhand meiner Noten
war nicht von Anfang an klar,
dass ich es ins Medizinstudium
schaffen würde. Dennoch war ich
davon überzeugt, dass die Medizin
das ist, was ich machen wollte. Ich
habe dann also ein Praktikum im
Stadtkrankenhaus gemacht. Was
mir dabei immer besonders gefallen
hat, war die Interaktion mit den
Patienten. Somit verfolgte ich mein
Ziel dann auch zielstrebig im Zivildienst.
Ich arbeitete in einer Notfallambulanz.
Und wie es häufig
so ist, die Menschen gehen feiern,
fallen betrunken in der Altstadt
hin und landeten dann in der Notaufnahme.
Ich durfte so viel nähen,
dass ich zunächst dachte, dass ich
definitiv Chirurg werde (lacht).
Letzten Endes bin ich dann durch
eine Kombination aus Interview
und Medizinertest ins Studium
aufgenommen worden. Auch das
war nicht so einfach, weil ich im
Interview in Düsseldorf Initial versagt
habe. Ich saß mit einer Gruppe
von Professoren zusammen und
wurde gefragt was ich denn eigentlich
werden wolle. Ich sagte, dass
ich mich sehr freuen würde Arzt zu
werden. Die Wissenschaft interessiere
mich aber weniger - dies wurde
mir angekreidet. Ich musste also
einige Hürden nehmen, bis ich zum
Medizinstudium kam.
Umso größer war die Verblüffung
meiner Eltern, als ich mich nach
der Studienplatzzusage völlig gewandelt
habe. Ich nahm das Leben
ernst und habe auch mit dem Lernen
begonnen.
Haben Sie auch mal mit einem
anderen Studienfach geliebäugelt?
Nein. Das habe ich eigentlich nie.
Es kam auch nie etwas anderes in
Frage und mit meinem Praktikum
im Krankenhaus hatte ich mir das
einfach nochmals bestätigt. Es war
auch nicht so einfach, weil meine
heutige Frau zu mir nach Düsseldorf
gezogen ist; ich aber einen Studienplatz
in Hamburg erhalten hatte.
Folglich musste ich dann über
mehrere Ecken den Studienplatz
tauschen und einigen Aufwand betreiben
damit ich das Ganze nicht
in den Sand setzen würde.
Würden Sie Ihren Kindern
heute noch raten Medizin zu
studieren?
Ja, auf alle Fälle. Ich muss dazu sagen,
dass ich meine Kinder nicht
in die Medizin und auch in keine
andere Richtung dränge. Mir ist
es wichtig, dass sie von alleine herausfinden,
was ihnen Spaß macht.
Dennoch, ich habe drei Kinder
und meine älteste Tochter interessiert
sich für Medizin. Auch wenn
sie noch ein wenig Probleme damit
hat, Blut zu sehen. Man muss jedoch
wirklich Medizin studieren
wollen, wenn man heute Millionär
werden möchte, sollte man lieber
etwas anderes studieren.
In welchem Land würden Sie
Ihren Kindern raten, Medizin
zu studieren?
Naja, meine Kinder sind Amerikaner.
Die Älteste ist zwar in Düsseldorf
geboren. Allerdings war sie
neun Monate alt als sie mit uns
in die USA gegangen ist. Ich sage
immer: "Ich habe amerikanische
Kinder mit europäischem Tatsch". Das ist meiner Frau und mir auch
immer wichtig. Unsere Kinder
sind schon ein wenig anders. Sie
sagen immer: "We are European".
Wenn ich selbstlos bin, sage ich
meinen Kindern natürlich "geht
wohin ihr auch immer wollt, um
zu studieren". Ansonsten wäre
es natürlich sehr schön, wenn sie
nahe bei uns bleiben würden.
Würden Sie ihren Kindern also zu
keinem bestimmten Land raten?
Naja. Ist die Ausbildung in den
USA besser als in Deutschland?
Ich denke diese Frage lässt sich eindeutig
bejahen. Es sind viel weniger
Studenten. Alles ist deutlich besser
organisiert und man hat vier klar
strukturierte Jahre mit viel praktischer
Ausbildung. Die Schattenseite
ist, dass das Medizinstudium
in den USA einfach unglaublich
teuer ist. Man muss sich fragen,
ob es gerechtfertigt ist, dass hier
ein Medizinstudent mit 150.000 -
250.000 $ Schulden seinen Beruf
antritt. Man muss überlegen, ob
jemand wie Sie oder ich schlechter
ausgebildet worden ist. Lohnt es
sich wirklich so viel Geld auszugeben.
Ehrlich gesagt, ich bin da skeptisch.
Es ist eine tolle Ausbildung,
die man hier bekommt. Keine Frage.
Aber ist sie wirklich so viel Geld
wert und ist sie so viel besser? Wie
man sehen kann war meine Ausbildung
in Essen sehr gut, und ich
habe es durchaus geschafft mich
hier durchzusetzen.
Lassen sich mit einem amerikanischen
Ärztegehalt diese Schulden
nicht deutlich schneller abbezahlen
als mit einem deutschen
Gehalt?
Das stimmt nur bedingt. Zwar
verdienen meine chirurgischen
Kollegen oder Kollegen, die Interventionen
betreiben hier am John
Hopkins Hospital sicherlich mehr
als ein Pädiater/Genetiker. Aber
es kommt darauf an, wo man lebt.
Wenn man z.B. in New York, Boston
oder Los Angelos lebt, verdient
man zwar mehr. Aber nicht so viel,
dass es die höheren Lebenskosten
ausgleichen würde. Ich setze mich
viel damit auseinander, da ich in
der Lehre und der Curriculumgestaltung
beteiligt bin. Natürlich, es
gibt viele small-group sessions und
die Lehrer empfinden es als eine
persönliche Niederlage, wenn Sie
das Gefühl haben oder die Rückmeldung
bekommen, eine schlechte
Lehre gemacht zu haben. Diese Philosophie
ist in Deutschland nicht
ganz so ausgeprägt. In Deutschland
hat man häufig nur Resepkt
vor dem Professor und das Prinzip,
dass Studierenden eine Möglichkeit
haben, konstruktiv Kritik zu üben,
habe ich während meines Studiums
nicht erlebt.
Wovon ich auf jeden Fall überzeugt
bin ist, dass die Assistenzarztausbildung
- die sog. Residency - in
den USA deutlich besser ist als in
Deutschland. In Deutschland
gibt es eine Menge ausgezeichnete
Ärzte, die einen hervorragend Job
machen, keine Frage, aber ob sie
immer die Hingabe und das Verantwortungsbewusstsein
zur Lehre
haben... Das bezweifele ich stark,
ohne damit jemandem zu nahe zu
treten. Wenn mich Leute fragen,
was ist der größte Unterschied zwischen
Amerika und Deutschland,
dann gebe ich meist folgende Antwort:
Ich habe zwei Jahre in Essen
in der Klinik gearbeitet und habe
dort zwei Oberärzte gehabt die
meine großen Vorbilder waren. Der
eine war der Klinikchef und mein
Doktorvater. Er ist zwar heute mehr
ein Freund, aber immer noch einer
der besten Ärzte, die ich kenne.
Dann gab es noch einen Oberarzt
in der Klinik, der einfach ein fantastischer
Arzt war. Das waren die
zwei Ärzte, die ich unwahrscheinlich
in mein Herz geschlossen habe.
Es waren für mich aber Einzelfälle.
Als ich dann hier an die John
Hopkins University gekommen
bin, habe ich plötzlich mindestens
10 solcher Ärzte um mich herum
gehabt. Es gibt in den USA nicht
bessere Mediziner, aber viel mehr
gute Vorbilder und Menschen, die
Freude daran haben einem etwas
beizubringen und daran interessiert
sind, dass man weiter kommt. Das
ist der größte Unterschied.
Warum sind Sie denn, wenn Sie
in Deutschland so hervorragende
Vorbilder hatten, dennoch in die
USA gegangen?
Ich habe damals meine Doktorarbeit
über Lipidspeichermyopathien
bei Kindern gemacht. Ich musste
dabei zunächst Kindern Blut abnehmen
und anschließend haben
wir versucht meine Fragestellung
zu beantworten. Am Ende stellten
wir einen Statistiker an, der mir
geholfen hat meinen Ergebnissen
so zu analysieren, dass am Ende
etwas interessanter dabei herausgekommen
ist. Das hat für mich
die Wissenschaft sehr unattraktiv
gemacht. Also bin ich zu meinem
damaligen Chef gegangen und
habe gesagt, dass ich jetzt gerne im
Bereich der Basiswissenschaften arbeiten
möchte. Mein Chef hat mir
geraten, einen Antrag bei der deutschen
Forschungsgesellschaft zu
stellen und ins Ausland zu gehen.
Das Gebiet, welches mich wirklich
interessierte, waren die Muskeldystrophien.
Da mein Chef beste
Kontakte zu Prof. Kevin Campbell
in Iowa hatte, zogen meine Familie
und ich für drei Jahre in die USA.
Das war ein unglaublicher Sprung.
Nach diesen drei Jahren Postdoc-
Zeit beschlossen wir in den USA
zu bleiben. Neben den beruflichen
gab es auch ein paar persönliche
Gründe: Meine Frau und ich gehören
beide der jüdischen Religion an
und wollten, dass unsere Kinder in
einem Land aufwachsen, indem es
einfacher und selbstverständlicher
ist eine jüdische Ausbildung zu
erhalten. Inzwischen hat sich das
auch in Deutschland alles geändert
- Es gibt beispielsweise jüdische
Schulen. Uns war das einfach
sehr wichtig, sodass ich letztendlich
einen längeren Karriereweg
gegangen bin.
Gab es für Sie bestimmte Hürden
um in den USA einzusteigen?
Naja, Sie müssen zusätzlich die USMLE
Prüfungen Step 1-3 machen
und wenn man sich die Option
offen halten möchte in den USA
zu bleiben, muss man die richtigen
Schritte bezüglich des Visums einleiten.
Ich habe erst gestern mit jemandem
darüber gesprochen. Er
hat mich gefragt, ob er das machen
sollte. Normalerweise bekommt
man ein Visum für die Residency
(Assistenzarztausbildung) und
muss danach wieder in sein Heimatland.
Wenn man mit dem Gedanken
spielt in den USA zu bleiben,
ist es am sinnvollsten sich um
eine Greencard zu bewerben. Das
kostet aber einige tausend Dollar
und man sollte sich im Klaren sein,
ob man das investieren möchte.
Gibt es Ihrer Meinung nach einen
geeigneten Zeitpunkt, um
sich auf die USA vorzubereiten?
Ich denke man sollte das während des Studiums machen. Die amerikanischen
Examen sind am einfachsten
zu absolvieren, wenn das
Wissen aus dem Studium noch
frisch ist. Hat man diese lästigen
Examen hinter sich gebracht, kann
man später mehr Zeit auf das verwenden,
was man wirklich machen
möchte.
Auf Ihrer offiziellen Internetpräsenz
sind sie als Associate Professor
für Neurologie und Pädiatrie
aber auch als Fachmann für
Genetik ausgewiesen. Wie kann
man das verstehen?
Das Grundprinzip ist, dass man
an vielen Universitäten als Genetiker
noch zusätzlich ein akademisches
Zuhause in einer größeren
Disziplin braucht. Deshalb
bin ich offiziell Fakultätsmitglied
der Neurologie und Pädiatrie.
Hauptsächlich arbeite ich aber als
Genetiker. Einmal im Jahr arbeite
ich aber auch als Ward-Attending
im Bereich der Kinderheilkunde
und kümmere mich dann um Klinik
und Lehre der Allgemeinen
Pädiatrie.
WWie kann man sich Ihre tägliche
Arbeit vorstellen?
Ungefähr alle zwei Wochen arbeite
ich in der Klinik. Da sehe ich vorwiegend
Patienten mit Muskelerkrankungen.
dann kümmere ich
mich sehr viel um mein Labor und
die Wissenschaft, wo ich auch als
Doktorvater von Studenten fungiere
und schließlich bin ich noch
als Residency Director für Genetik
tätig, wo ich mich natürlich auch
um meine Fellows zu kümmern.
Das zusammen füllt dann ganz gut
die Woche.
Ihr Forschungsschwerpunkt sind
die Muskeldystrophien. Wie kamen
Sie dazu Erdhörnchen als
Modellorganismus zu wählen?
Vor drei Jahren gab es eine Ausschreibung
für innovative wissenschaftliche
Ideen vom National
Institutes of Health (NIH). Im
Prinzip ging es darum, Stipendienanträge
zu sammeln, die eine interessante
wissenschaftliche Frage
stellen und einen ungewöhnlichen
Weg zu deren Beantwortung ausgewählt
haben. Man brauchte also
einfach nur eine gute Idee, ohne,
dass man im Vorfeld schon viele
Ergebnisse vorweisen musste. Normalerweise
ist das ja ganz anders.
Da muss man für ein Stipendium
schon eine ganze Menge an Daten
haben. Das brauchte ich in diesem
Fall nicht. Ich musste nur einen
10-seitigen Aufsatz schreiben und
die Idee präsentieren.
Das mag zwar jetzt ein wenig komisch
klingen, aber Bären haben
mich schon als Kind sehr fasziniert
und in diesem Zusammenhang
auch das Phänomen des Winterschlafes.
Immer wenn ich im Winter
in den Zoo gegangen bin, konnte
ich keine Bären sehen, weil diese
schliefen.
Ich habe mir also überlegt, ob man
daraus nicht irgendwie Forschung
machen könnte. Schließlich ruhen
Winterschlaf haltende Tiere
für sechs Monate und entwickeln
trotzdem keine Muskelatrophie.
Beim Menschen würde eine solch'
lange Ruhephase zu einem massivem
Muskelschwund führen. Im
Prinzip haben diese Tiere die biologische
Frage schon gelöst, nach der
wir Wissenschaftler suchen (lacht).
Ich habe mich dann zunächst erkundigt,
welches Tiermodell am
einfachsten zu realisieren wäre.
Dass man Bären schwierig im Labor
halten kann, ist einleuchtend
(lacht). Eine Kollegin, die eine Kolonie
Winterschlaf haltender Erdhörnchen
aufgebaut hatte, half mir
schließlich. Es ist natürlich nicht
so, als ob ich der erste gewesen
wäre, der darüber nachgedacht hat.
Aber interessanterweise hat man
dieses Tiermodell bis dato eher im
Zusammenhang mit der Sauerstoffversorgung
der Organe oder der
Funktion des Darmtrakts, der sechs
Monate nichts zu tun hat und dann
gleich voll belastet wird, eingesetzt.
Es gibt wissenschaftlich gesehen so
viele unglaublich interessante Fragen,
sodass ich Glück hatte, dass
die Leute bisher noch nicht richtig
in die Tiefe gegangen sind und über
Erhaltung der Muskelmasse nachgedacht
hatten. Ich habe auf jeden
Fall den Antrag gestellt und das
Geld in Höhe von 1,5 Millionen
Dollar bekommen. Damit konnte
die Forschung am Erdhörnchenmodell
und den Muskeldystrophien
eine andere Dimension bekommen.
Ich muss sagen, diese Forschung
ist schon wahnsinnig spannend.
Wir haben z.B. ein neues Protein
entdeckt, dass mit Winterschlaf
und Muskelerhalt zusammenhängt
und bisher nur in der Niere und im Gehirn von nicht Winterschlaf
haltenden Tieren bekannt war. Im
Weiteren haben wir im Mausmodell
festgestellt, dass dieses Protein
wirklich eine wichtige Rolle für die
Verhinderung des Muskelschwunds
spielt. Inzwischen haben wir sogar
ein Patent. Die Frage bleibt natürlich,
welche therapeutische Relevanz
dem Protein zukommt. Biologisch
gesehen ist es aber dennoch
eine sehr interessante Entdeckung.
Was war denn bisher das absolute
Highlight und die größte Enttäuschung
in Ihrer Forscherlaufbahn?
Ah, das ist aber eine
schwierige Frage. Ich
denke, dass jede wissenschaftliche
Geschichte,
an der ich gearbeitet habe,
sehr aufregend gewesen ist.
Sodass ich es meist sogar
noch über mehrere Jahre
hinweg genießen konnte,
dass wir etwas Wichtiges
herausgefunden haben.
Eine der aufregendsten
Zeiten war sicherlich das
mit den Erdhörnchen.
Also da hatten wir eine
Idee und als sich dann
herauskristallisierte, dass
wirklich etwas Wichtiges
dahinter stecken könnte - das war
schon unglaublich spannend.
Am schwierigsten war die Zeit, in
der wir über fast eineinhalb Jahre
hinweg versucht haben, unsere Erkenntisse
von den Erdhörnchen zu
publizieren. Dabei ist mir klar geworden,
dass es schwierig sein kann,
ein Top Journal davon zu überzeugen,
dass Winterschlaf haltende
Erdhörnchen ein wichtiges Modell
sind. Das war zwischendurch unheimlich
frustrierend.
Hingegen hatte ich jetzt eine Studentin,
die gerade in Science Translational
Medicne publiziert hat.
Das Paper wurde innerhalb von
acht Wochen angenommen. So
schnell ging es bei mir noch nie. Ich
denke, manchmal braucht man ein
wenig Glück. Die Editoren müssen
die Geschichte mögen.
Ups und Downs gibt es in der Wissenschaft
immer wieder. Glücklicherweise
habe ich noch immer
mehr Ups als Downs gehabt.
Aus Ihrer Publikationsliste geht
hervor, dass Sie in sehr angesehenen
Journals publiziert haben,
wie z.B. "The Cell" oder "Nature".
Was würden Sie Nachwuchsforschern
raten, wenn sie
in der Wissenschaft Fuß fassen
wollen?
Auf einen guten Mentor zu achten.
Das ist meiner Meinung nach das
A und O, sich jemanden auszusuchen,
der einem helfen kann wissenschaftliche
Fragen zu stellen,
sich Ergebnisse ansieht und ein
bisschen über den eigenen Tellerrand
hinauszusehen vermag. Es
gibt unwahrscheinlich viele Wissenschaftler,
die sich um ihre eingegrenzten
Probleme kümmern - die
auch wichtig und interessant sind.
Aber gerade als Mediziner- wenn
man neben der Klinik forscht -
ist es wichtig einen guten Mentor
zu haben, um vielleicht auch eine
medizinische Relevanz zu finden.
Darüber hinaus sollte man sich ein
gutes Labor aussuchen.
Ich denke, ich hatte da
einfach Glück. Wobei
es Leute gibt, die sagen,
dass es kein Glück
in der Forschung gibt
und man nur die Augen
offen halten muss,
um nachher zu entscheiden,
was man
macht. Ich denke aber
dennoch, dass man ein
wenig Glück braucht.
Zwar habe ich bisher
in guten Journals publiziert.
Es gibt allerdings
sehr gute Leute
in der Forschung, die
nicht so hoch publizieren,
aber dennoch
sehr gute Forschung machen. Insgesamt
hatte ich drei Mentoren, einen
in Deutschland, einen in Iowa
und einen hier am John Hopkins
Hospital. Das waren immer Leute,
die sich Mühe gegeben haben, dass
ich erfolgreich bin. Ich glaube, das
braucht man.
Also jemanden, der einem etwas
gönnt und den Erfolg unterstützt?
Absolut. Das ist gerade in Deutschland
oft ein Problem. Da ist man
auf einmal junger Assistenzarzt
oder junger Oberarzt und dann
holt man sich Studenten, die dann
an dritte oder vierte Stelle in der
Publikation kommen, obwohl sie
die Arbeit machen. Das Prinzip
gibt es hier nicht. Wer in den USA
die Arbeit macht, der bekommt
auch die Anerkennung. Also meistens
jedenfalls. Natürlich gibt es
auch hier Ausnahmen.
Wenn wir den Blick wieder mehr
aufs Klinische richten. Wie schätzen
Sie die Zukunft ihres Faches
ein?
Ich denke, dass die Genetik, auf
Grund der Technologie, die immer
weiter entwickelt wird, das
medizinische Weltbild vollständig
verändern wird. Ansätze wie
die gesamte Sequenzierung des
menschlichen Genoms gibt es
schon. Die werden bald nur noch
1.000 $ kosten und dann wird das
zur Routine werden. Anschließend
braucht man Genetiker, die
sich klinisch und wissenschaft lich
mit der Bedeutung dieser gesamten
Daten auseinandersetzen.
In Bezug auf den Bereich der Muskelerkrankung,
haben wir immer
mehr die Möglichkeit, die Erkrankungen
genetisch zu defi nieren.
Dies trifft aber letztlich auf fast
alle Erkrankungen zu. Wenn ich
heute Patienten sehe, dann können
wir den primären Gendefekt noch
nicht therapieren. Aber das wird
sich innerhalb der nächsten zehn
Jahre verändern. Dann werden
wir Gensequenzierungen des gesamten
Patientengenoms machen
und dort therapeutisch ansetzen.
Wenn man die Krankheit verursachenden
Gene kennt, wird man
die Pathways entschlüsseln und
verstehen, warum z.B. ein Kind
mit seinen Krampfanfällen auf
Keppra (Medikament zur Behandlung
von Epilepsie) anspricht und
das andere nicht. Wir werden eine
ganz andere Medizin im Bereich
der genetischen Erkrankungen betreiben
können.
Ich denke, dass das auch später
Auswirkungen auf nicht primär
genetische Erkrankungen haben
wird. Da bin ich mir sogar recht sicher.
Ich glaube, dass die genetische
Information, die wir innerhalb der
nächsten Jahre anhäufen werden,
die komplette medizinische Welt
verändern wird - so versuche ich
das zumindest meinen Studenten
zu verkaufen, um sie davon zu
überzeugen in die Genetik zu gehen
(lacht). Dann sage ich immer:
"Wenn ihr ein Teil dieser Revolution
sein wollt, dann solltet ihr jetzt
in die Genetik einsteigen".
Neben Ihrem Beruf haben Sie zu
Beginn einmal Ihre Familie erwähnt
- dass sie verheiratet sind
und drei Kinder haben. Wie fi nden
Sie neben all den berufl ichen
Verpfl ichtungen Ausgleich?
Den Ausgleich fi nde ich, indem
ich mir die Zeit, die ich brauche,
einfach nehme. Ich denke, es gibt
viele Kollegen von mir, die sich ununterbrochen
nur mit ihrer Arbeit
auseinander setzen. Das mache ich
nicht. Vielleicht könnte ich mir
die Frage stellen, ob ich nicht früher
mit meinem Labor hätte publizieren
können, wenn ich mich
nur noch mehr dafür eingesetzt
hätte. Allerdings arbeite ich schon
relativ viel. An den Wochenenden
versuche ich so wenig wie möglich
zu arbeiten und wenn ich abends
nach Hause komme, dann versuche
ich rechtzeitig zu Hause
zu sein, um mit meinen Kindern
Abend zu essen und mich um
die Hausaufgaben kümmern zu
können. Wenn es dann mal ganz
wichtig ist, setze ich mich abends
Zuhause nochmal hin und arbeite.
Also ich nehme mir ganz bewusst
die Zeit und weiß auch, dass ich
mir dadurch vielleicht hier und da
etwas Zeit für den berufl ichen Erfolg
wegnehme. Aber am Ende des Tages bringt es mir nichts, wenn
ich den Nobelpreis erhalte und
dafür meine Kinder nicht wissen
wer ich bin. Das ist natürlich eine
sehr persönliche Entscheidung.
Ich muss sagen, dass ich viele Leute
kenne - sowohl in Deutschland
als auch in den USA- denen die
Karriere wichtiger gewesen ist. Ich
möchte jetzt auch nicht den Eindruck
hinterlassen, dass ich nicht
ehrgeizig bin. Natürlich kümmere
ich mich sehr viel um meine Karriere.
Es ist mir aber einfach wichtig,
dass ich eine gute Beziehung zu
meinen Kindern aufb aue und ich
glaube, dass schätzen sie sehr
Was sind Ihre persönlichen
Ziele für die Zukunft ?
Ich möchte schon versuchen, Leiter
einer Klinik zu werden, sodass
ich meine Philosophie von der
Kinderheilkunde und der Genetik
auf ein ganzes Department übertragen
kann. Dies ist eine gesunde
Mischung aus Interesse an Wissenschaft
, Klinik und dass man
jungen Leuten beibringen kann,
wie man mit Patienten und Familien
umgeht. Das ist mein Ziel.
Dazu gehört auch, Menschen das
Gefühl zu vermitteln, dass es mir
wichtig ist, dass sie Erfolg haben
aber gleichzeitig auch Rücksicht
auf Ihr Privatleben haben. Wenn
es Zuhause nicht funktioniert,
dann will ich sie auch nicht in der
Arbeit sehen. Das habe ich von
meinem Mentor in Iowa gelernt,
der als einer der führenden Wissenschaft
ler im Bereich der Muskeldystrophien
sehr erfolgreich ist
und dennoch ein hervorragendes
Familienleben hat. So sehr man
bei ihm auch unter Druck stand
-und das war wirklich ein hoher
Druck (lacht) -konnte man sich
sofort darum kümmern, wenn irgendetwas
mit der Familie war. Da
gab es keine Diskussion. Es gibt
viele Dinge, die neben der Wissenschaft
wichtig sind. Die Familie,
aber beispielsweise auch die Art
und Weise, wie man mit Patienten
und deren Familienangehörigen
umgeht.
Das klingt für mich nach einem
humanistischen Ansatz, der
heute in der von ökonomischen
Interessen dominierten Medizin
kaum noch zu fi nden ist.
Ja, da haben sie recht. Umso wichtiger
ist es mir, dass von einer
Führungsposition aus vorleben zu
können.
Gibt es ihrer Meinung nach etwas
wie eine "goldene Regeln"
in Bezug auf den medizinischen
Lebensweg, die Sie Studierenden
mit auf den Weg geben würden?
Dass man sich für das entscheiden
sollte, für das man am meisten
Hingabe hat. Also was einem
am meisten Spaß und am meisten
Vollendung bringt. Dem soll man
nachgehen. Wenn man das macht,
dann wird man auch erfolgreich
sein. Sicherlich, diesen Bereich
muss man erst fi nden und es gibt
Menschen, die ihn schnell fi nden
und andere müssen länger danach
suchen.